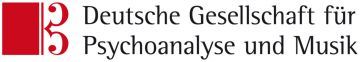Aktuelles
TRÄUME*N in Psychoanalyse und Musik
13. Symposion für Psychoanalyse und Musik
07. – 09. November 2025 in Rostock
—
Tagungskonzeption und Organisation: Annegret Körber
Trailer des Eröffnungsfilms:
Genaue Informationen zu Programm, Kosten und Anmeldung entnehmen Sie bitte dem Flyer:
Weitere Informationen:
VERANSTALTUNGSORTE

Hochschule für Musik und Theater Rostock [hmt]
Beim St.-Katharinenstift 8
18055 Rostock
www.hmt-rostock.de

Lichtspieltheater Wundervoll [li.wu]
Friedrichstraße 23
18057 Rostock
www.liwu.de
HOTELEMPFEHLUNGEN
Hotel Citymaxx
Dierkower Damm 50
18146 Rostock
Pentahotel Rostock
Schwaansche Str. 6
18055 Rostock
Motel One Rostock
Schröderplatz 2
18057 Rostock
B&B Hotel Rostock-Hafen
Gaffelschonerweg 1
18055 Rostock
Radisson Blu Hotel Rostock
Lange Str. 40
18055 Rostock
Vienna House by Wyndham Sonne Rostock
Neuer Markt 2
18055 Rostock