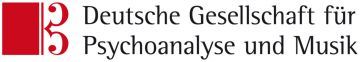TRÄUME*N – VORTRÄGE
13. Symposium der DGPM
Claus Braun
Die traumzentrierte Gruppe – Container, Wandlungsraum, Sinnstifterin
In meiner Praxis biete ich seit langem eine ambulante traumzentrierte psychoanalytische Gruppe für Erwachsene an. Es wird in jeder der wöchentlichen Sitzungen ein Traum aus der Gruppe eingebracht und nach einem vorgegebenen Schema bearbeitet. Im Zentrum des Gruppenprozesses steht die imaginative Aneignung der jeweiligen Traumgeschichte und ihre Szenen durch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe. Die Assoziationen und Einfälle aus der Gruppe amplifizieren das jeweilige Traumereignis, ein Prozess der regelmäßig als emotional berührend und bereichernd erfahren wird. Ich werde Beispiele von markanten Traumereignissen aus dem Gruppenprozess mitbringen und für spezifische Träume, die etwa den Musiker:innenberuf oder sozialpolitische Ereignisse spiegeln.
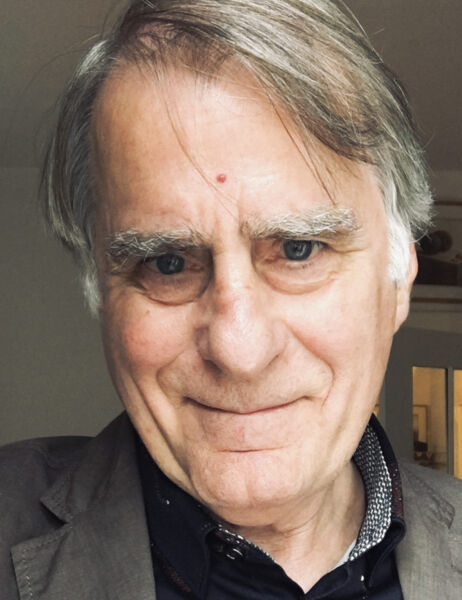 Dr. med. Dipl.-Psych. Claus Braun, Berlin
Dr. med. Dipl.-Psych. Claus Braun, BerlinArzt für Psychiatrie und Neurologie, Arzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoanalytiker, Dozent IfP, Lehranalytiker DGAP/DGPT, Gruppenlehranalytiker D3G, wiss. Interessen: Intersubjektivität, Traumgeschehen, fachspezifische Veröffentlichungen, zuletzt Traumarbeit in Gruppen (Hrsg., Brandes & Apsel), Mit Träumen zu sich finden (Brandes & Apsel, 2025).
Gisela Linnen
Traummusiken: Träume*n als musikalisches Sujet
Als erzählerische Figur und Vorgang zeigen sich Traum und Träumen in musikalischen Werken im Spannungsfeld von kompositorischer Konstruktion und semantischer Vermittlung. Sie erscheinen universal verortet in unterschiedlichen Dimensionen und Gattungen europäischer Musik: als programmatischer Titel, als Traumdarstellung oder -vision, sequenzartig sowie als Formprinzip in Lied, Chor- und Orchesterwerken, im Musiktheater oder medial kombiniert als Filmmusik. Anhand musikalischer Beispiele werden kompositorische Organisationsprinzipien und Strategien vorgestellt, die dazu eingesetzt werden, einen Zustand des Träumens bzw. des Traums musikalisch zu inszenieren. Der Fokus wird darauf gelegt, unterschiedliche Arten und Qualitäten des Ausdrucks und diverse Logiken der musikalischen Raum- und Formenbildungen in ihrer Wirkung gemeinsam zu entdecken und analytisch zu entschlüsseln. Außerdem wird beleuchtet, wie innerhalb der Erschaffung einer musikalischen Wirklichkeit, die sich gegenüber der Wirklichkeit absetzt, in der sie geschieht, durch die Darstellung von traumassoziierten musikalischen Gestaltungsprozessen eine zusätzliche Erlebensdimension von musikalischer Wirklichkeit etabliert wird. Ziel ist, allgemeine und besondere Parameter der psychologischen Wirkung musiktheoretisch zugänglich zu machen und dadurch ein tieferes Verständnis für Produktionsbedingungen von charakteristischen Klang- und Zeitqualitäten zu vermitteln, die der Darstellung von traumassoziierten musikalischen Gestaltungsprozessen dienen.
 Dr. phil. Gisela Linnen, Berlin
Dr. phil. Gisela Linnen, BerlinM.A. Musiktheoretikerin, Dipl. Musiktherapeutin, Dipl. Pianistin, Gastdozentin für Musiktherapieforschung, Codarts hoogeschool voor de kunsten, Rotterdam; 2024-2025 Gastprofessorin für Musiktheorie, UdK Berlin; Klinische Musiktherapeutin; Forschungsschwerpunkte: psychologische Prozesse und psychohistorische Effekte in individuellen musikalischen Stilbildungen
Dalibor Davidović
Syberbergs Traum, was sonst?
Musik ist im Werk des Künstlers Hans Jürgen Syberberg allgegenwärtig. Sie erklingt nicht nur in Syberbergs Filmen und ortsspezifischen Arbeiten, sondern durchdringt auf die eine oder andere Weise oft auch seine Schriften, Aufzeichnungen und Tagebucheinträge. Andererseits begegnet man in Syberbergs Arbeiten nicht nur Sequenzen, die Träume, Träumereien oder Trauminhalte darstellen, sondern diese nehmen meist die Bedeutung eines Wendepunkts an. Doch welche Rolle spielen Musik und das Träumen in Syberbergs Werk? Inwiefern konvergieren, berühren und unterstützen sie sich gegenseitig, inwiefern weichen sie voneinander ab und schließen sich möglicherweise aus? Und schließlich: Erscheint angesichts des beispiellosen Eintauchens des Künstlers in die verschwundene Welt seiner eigenen Kindheit sein gesamtes Werk nicht wie eine Art Traum?
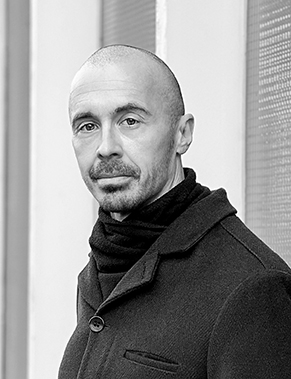 Prof. Dr. Dalibor Davidović, Zagreb
Prof. Dr. Dalibor Davidović, ZagrebMusikwissenschaftler, lehrt an der Universität Zagreb und ist Gastprofessor an der Universität Graz; Veröffentlichungen u.a. zu Hans-Jürgen Syberberg: Nach dem Ende der Welt (2020) und Syberberg, die Kunst mit dem Ohr gedacht (erscheint in Kürze)
Sebastian Leikert
Musik Traum Körper – Behandlungstechnische Überlegungen zum körperorientierten Durcharbeiten des Traums
Der Vortrag erkundet die Verbindung zwischen Traum, Musik und Körper. Freud hat uns gelehrt, den Traum als Phänomen zu begreifen in dem sich psychisches Leben auf eine einzigartige Weise konzentriert. Gleichzeitig hat er einen bestimmten Aspekt - den dissoziierten Charakter des Traums - zwar beschrieben, aber behandlungstechnisch nicht berücksichtigt. Freud analysiert den Traum als „Hüter des Schlafs“, schildert die „stillgelegte Motilität im Schlaf“ und untersucht die Wirkung des Schlafzustandes auf die Affektabwehr. Der Traum entfaltet sich also zunächst dissoziiert von Affektleben und Körperselbst. Im Gegensatz dazu ist Musik ohne ihre innige Verbundenheit mit dem Körperselbst nicht sinnvoll zu denken. Musik ist ein integrierendes Medium, das Affektleben, Bewusstsein und Körperlichkeit synchronisiert. Mit dieser integrierenden Wirkung hat die Musik seit den Ritualen der Altsteinzeit eine bedeutsame Rolle in der Kulturentwicklung des Menschen gespielt. Anhand von klinischen Beispielen schildere ich einen behandlungstechnischen Zugang zum Traum, der gezielt die dissoziierte Verbindung zum Körperselbst wieder herstellt (somatische Narration), die Deutung des Traums um eine wesentliche Dimension bereichert und dadurch hoch effektiv ist.
 Dr. en psychanalyse Sebastian Leikert, Saarbrücken
Dr. en psychanalyse Sebastian Leikert, SaarbrückenPsychoanalytiker, Supervisor, Lehranalytiker, tätig in eigener Praxis; publiziert zu ästhetischen und klinischen Themen; Vorsitzender der DGPM; Mitglied im Editorial Board des International Journal of Psychoanalysis.
Julia Deppert-Lang und Benjamin Lang
Geträumte Natur: Wie Naturphänomene zu Klang werden
Anhand der Kompositionen „Magma“ für Violoncello und Klavier von Julia Deppert-Lang und „Skagsanden“ für Violine solo von Benjamin Lang zeigen die beiden Komponisten, wie in ihren Werken Naturphänomene in Klanggestalt übertragen werden. Julia Deppert-Lang beschäftigt sich mit dem geschmolzenen oder halbgeschmolzenen Material im Untergrund der Erde, das aus flüssigem Gestein besteht, jedoch auch feste Kristalle und Gasblasen enthält. Sobald das Magma an der Erdoberfläche austritt, wird es als Lava bezeichnet. Bei Benjamin Lang wird die Landschaft rund um den Strand „Skagsanden“ in Flakstad auf den Lofoten in Norwegen thematisiert. Die Formen und Strukturen der umliegenden Berglandschaft können als repetitiv empfunden werden und insbesondere für den zeitlichen, formalen Aufbau der Komposition klangliche Assoziationen bieten. Beide Kompositionen beruhen letztendlich auf einer imaginierten Vorstellung der Natur. Während „Magma“ zunächst eher auf dem Wissen über das Phänomen basiert, orientiert sich „Skagsanden“ an einer bildlichen Erinnerung eines Erlebnisses. In dem Vortrag soll ein Einblick in die unterschiedlichen kompositorischen Prozesse und Gedankengänge gegeben werden.
 Dr. Julia Deppert-Lang, Rostock
Dr. Julia Deppert-Lang, RostockKomponistin, Musiktheoretikerin, Geigerin und Violinpädagogin. Sie arbeitet als Dozentin für Musiktheorie und Komposition an der Hochschule für Musik und Theater Rostock; ihre Werke werden im In- und Ausland aufgeführt.

Prof. Dr. Dr. Benjamin Lang, Rostock
Komponist, Musiktheoretiker und Dirigent, Professor und derzeit Rektor an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Seine Werke werden im In- und Ausland (ur-)aufgeführt und sind im Verlag Neue Musik erhältlich.
Antje Niebuhr
Der Traum als Verwandlungsraum- Reflexionen zur Oper Die tote Stadt von Erich Korngold
In Korngolds 1920 uraufgeführter Oper Die tote Stadt wird eine Traumerzählung inszeniert, durch die der Protagonist eine traumatische Verlusterfahrung transformieren kann. Nach der und durch die emotional tief aufwühlende Erfahrung des Traums kann er sich vom melancholischen Haften am Tod schließlich dem Leben wieder zuwenden. Traumgestaltende Kräfte, die wir auch aus dem psychoanalytischen Traumverständnis kennen, werden sowohl erzählerisch eingesetzt, als auch musikalisch verwendet. Illusion, Verleugnung, Verschiebung: In der Oper begegnen wir diesen Elementen – im Vortrag sollen sie exemplarisch aufgezeigt werden. Ein mitschwingender Subtext, der sich sowohl in Korngolds Biografie, als auch im rahmenden historischen Kontext aufdrängt, soll dabei nicht unbeachtet bleiben, wie auch nicht der Erzählkontext unseres Symposions, in dem das transformatorische Potenzial des Traums das zentrale Thema ist.
 Antje Niebuhr, Bremen
Antje Niebuhr, BremenAntje Niebuhr, Bremen Dipl.Psych., Psychoanalytikerin, niedergelassen in Bremen; tätig als Psychoanalytikerin/ Psychotherapeutin, Paartherapeutin, Supervisorin und Lehranalytikerin; in Ausbildung zur Gruppenanalytikerin; langjährig gestaltend tätig im Vorstand der DGPM mit Interesse an der Verbindung zwischen ästhetischen Prozessen und psychoanalytischem Denken